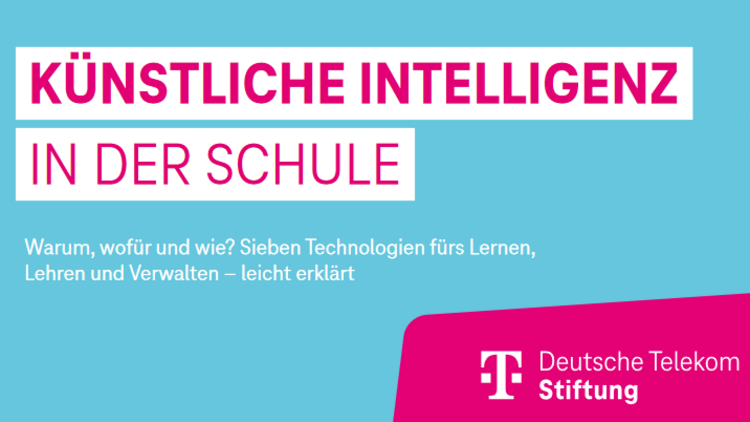Lernen im Zeitalter der Digitalität
Einstimmiger Beschluss des Landesvorstands vom 26. September 2025
Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt: Die digitale Transformation durchdringt alle Lebensbereiche. Sie fordert uns heraus, sie bietet Chancen, sie verlangt Haltung. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) stellt sich dieser Herausforderung. Wir setzen uns für eine Bildung ein, die Kinder und Jugendliche stark macht – durch Beziehung, Begeisterung und Sinn. Bildung, die nicht belehrt, sondern befähigt. Bildung, die nicht reproduziert, sondern transformiert. Eine Bildung im Zeitalter der Digitalität darf sich nicht auf Vermittlung reduzieren, sondern muss junge Menschen als aktive, verantwortungsvolle Mitgestaltende ihrer Lernwege ernst nehmen. Dieses Positionspapier formuliert unsere Vision für das Lernen im Zeitalter der Digitalität.
Von Digitalisierung zu Digitalität – eine begriffliche Orientierung
Digitalisierung bezeichnet den technischen Wandel – die Umwandlung analoger Prozesse in digitale. Doch der eigentliche Paradigmenwechsel liegt tiefer: In der „Kultur der Digitalität“ (Felix Stalder) verändert sich unser Denken, Kommunizieren und Lernen. Schule muss sich diesem Wandel stellen – nicht durch blinden Technikeinsatz, sondern durch reflektierte Bildung mit und über Digitalität (vgl. Döbeli Honegger, 2016; Huber & Schneider, 2021). Das umfasst sowohl die Nutzung digitaler Werkzeuge als auch die kritische Auseinandersetzung mit ihren Wirkungen, Mechanismen und gesellschaftlichen Konsequenzen.
Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge im Zentrum von Schulentwicklung
Künstliche Intelligenz (KI) ist kein Zukunftsthema mehr – sie ist längst Gegenwart. Ihre Potenziale reichen von personalisiertem Lernen über Diagnostik bis hin zur administrativen Entlastung. KI-gestützte Tools können Lehrkräften und Schulleitungen helfen, Routinetätigkeiten zu automatisieren, Feedbackprozesse zu unterstützen und Lernfortschritte differenziert sichtbar zu machen. KI muss als das Lernen und Lehren unterstützendes Werkzeug betrachtet werden – nicht als Ersatz für pädagogische Beziehungen. Bayernweite Schullizenzen für datenschutzkonforme und sinnvolle generative digitale Tools, Plattformen und Apps würden hier Sicherheit geben und entlasten, denn Fachleute und Ressourcen fehlen an allen Schularten, um hier gezielt auszuwählen. Innovation darf nicht an mangelnder Ausstattung oder zu schulartspezifisch gedachten Strategien scheitern. (vgl. Huber et al., 2024)
Bildung im Wandel: Chancen erkennen, Zukunft gestalten
Digitalität ist mehr als Technik. Sie ist Ausdruck einer sich wandelnden Kultur, die neue Formen des Zusammenlebens, Lernens und Arbeitens hervorbringt. In dieser Veränderung liegen immense Chancen: für die Individualisierung von Lernwegen, für kreative Ausdrucksformen, für neue Partizipationsmöglichkeiten. Doch diese Chancen entfalten sich nur, wenn Schulen zu Gestaltungsorten werden. Gute Digitalität muss vorgelebt werden – in der Schule, in der Verwaltung, in der Lehrkräftebildung. Diese Veränderung benötigt aber vor allem auch Zeit und Ressourcen.
Leitlinien zeitgemäßer Bildung
Der BLLV steht für ein Bildungsideal mit Herz, Kopf und Hand. Lernen ist Beziehung. Lernen braucht Sinn. Lernen braucht Begeisterung. Digitalisierung ist dabei keine Ersatzrealität, sondern eine mächtige Ergänzung. Digitale Medien müssen dort eingesetzt werden, wo sie einen echten Mehrwert für das Lernen und die Entwicklung junger Menschen schaffen. Medienkompetenz ist dabei kein Nice-tohave, sondern Grundvoraussetzung für mündiges, demokratisches Handeln. Medienbildung ist Haltung. Und Demokratielernen beginnt mit dem Verstehen digitaler Wirklichkeit.
Lernen als individueller, selbstbestimmter Prozess
Lernen ist kein Gleichschritt, sondern ein individueller Prozess. Die Schule der Zukunft ist nicht mehr primär ein Ort des Lehrens, sondern des Lernens. Schülerinnen und Schüler müssen ihr eigenes Lernen in die Hand nehmen dürfen. Sie müssen begleitet, nicht belehrt werden. Lernprozesse müssen sinnstiftend, relevant und kontextbezogen gestaltet sein. Die 4K-Kompetenzen – Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken – bilden dabei das Fundament für Zukunftsfähigkeit.
Neue Lern- und Prüfungskultur: Lernen bewerten, nicht bewachen
Eine neue Lernkultur erfordert eine neue Prüfungskultur. Lernen ist prozessorientiert – also müssen auch Prüfungen prozessorientiert sein. Leistungsbewertung darf nicht nur das Produkt in den Blick nehmen, sondern muss auch die Entwicklung würdigen. Prüfungsformate müssen flexibler, kreativer und individueller werden. Kompetenzorientierte, adaptive und projektbasierte Formate, welche auch das kollaborative Arbeiten sowie die Nutzung von KI enthalten, wären zeitgemäß. KI kann dabei zudem eine Rolle spielen: bei der Analyse von Lernfortschritten, bei der Erzeugung von Aufgaben oder beim formativen Feedback. Doch: Die Verantwortung für die Bewertung bleibt beim Menschen.
Lernförderliches Feedback: Chance für Wachstum
Feedback ist der Motor für Lernprozesse. Nach John Hattie ist die Rückmeldung über Fehler nicht Bestrafung, sondern Chance – für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin ebenso wie für das gesamte System. Lernförderliches Feedback muss kontinuierlich, dialogisch und individuell sein. KI kann bei der Bereitstellung von Feedback unterstützen, ersetzt aber nicht die reflektierende Begleitung durch die Lehrkraft. Eine neue Feedbackkultur braucht Zeit, Vertrauen und Raum zur Entwicklung. Sie ist Ausdruck einer veränderten Haltung zum Lernen selbst.
Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe und Fundament demokratischer Bildung
Medienkompetenz kann nicht nebenbei erworben werden. Sie ist zentrale Bildungsaufgabe im Zeitalter der Digitalität. Die notwendige Medienerziehung beginnt in der Grundschule und zieht sich durch alle Schularten und Jahrgangsstufen. Es geht nicht nur um Technik, sondern um kritisches Denken, ethische Reflexion und gesellschaftliche Verantwortung. Schule muss Kinder stark machen gegen Desinformation, Radikalisierung, Überforderung und Abhängigkeit. Die Fähigkeit, Informationen zu bewerten, den eigenen „Confirmation Bias“ zu reflektieren und Quellen kritisch zu hinterfragen, ist Grundlage demokratischer Mündigkeit. Medienbildung ist politische Bildung.
Schulentwicklung gestalten: strategisch, innovativ, kooperativ
Die digitale Transformation kann nur gelingen, wenn sie als Teil einer umfassenden Schulentwicklung gedacht wird. Schulentwicklung muss bewusst gesteuert werden: durch strategische Zielsetzungen, durch kluge Priorisierung (BIOplus-Ansatz: Bewahren, Innovieren, Optimieren, Sistieren; vgl. Huber et al., 2024) und durch kooperative Führungsstrukturen sowie das Ermöglichen von zielgerichteter Kooperation auf Ebene der Lehrkräfte. Schulleitungen sind zentrale Akteure dieses Wandels – sie brauchen Zeit, Ressourcen und Unterstützung. Professionelle Führung bedeutet, Räume für Innovation zu schaffen, Feedbackstrukturen aufzubauen und gemeinsam mit dem Kollegium eine wertegeleitete, lernförderliche Schulkultur zu entwickeln (vgl. Huber & Pruitt, 2024). Auch die Schulverwaltung selbst muss Teil der digitalen Transformation sein. Digitalisierung bietet nicht nur für das Lehren und Lernen, sondern auch für die Optimierung administrativer Prozesse enorme Potenziale. Überholte, analoge Verwaltungsstrukturen binden derzeit viel Zeit, Ressourcen und Energie. Effiziente, datensichere digitale Verwaltungsprozesse – von Stundenplanung über Personalverwaltung bis hin zur Kommunikation mit der Schulaufsicht – können Leitung und Kollegium entlasten und so Freiräume für pädagogische Innovation schaffen. Eine ganzheitliche Digitalstrategie muss daher auch die Verwaltungsdigitalisierung aktiv mitdenken.
Professionalisierung mit Haltung: Lehrkräftebildung neu denken
Die beste Ausstattung hilft wenig, wenn die Haltung nicht stimmt. Digitale Bildung darf in der Lehrkräftebildung nicht auf Tools beschränkt bleiben. Vielmehr braucht es eine methodisch-didaktisch fundierte Verankerung digitaler Medien sowie medienpädagogischer und ethisch-reflexiver Inhalte in allen Ausbildungsphasen – von der Universität über das Referendariat bis zur Fortbildung im Dienst. Bereits bestehende Orientierungsrahmen wie der DigCompEdu Bavaria bieten wertvolle Anknüpfungspunkte zur Kompetenzentwicklung von Lehrkräften im Umgang mit digitalen Medien. Diese sollten systematisch genutzt und weiterentwickelt werden. Doch nicht alles lässt sich durch Fortbildung lösen. Entscheidend ist die professionelle Haltung: Beziehungsorientierung, Neugier, Reflexion, Mut zur Veränderung. Schulen brauchen Zeit und Vertrauen, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen.
Infrastruktur und Ressourcen: Ermöglichung statt Technikfetisch
Digitale Bildung braucht eine stabile, funktionale Infrastruktur. Doch Technik allein macht keine gute Schule. Hochwertige Ausstattung ist notwendige Voraussetzung, aber kein Ziel. Entscheidend ist, dass Schulen ihre Konzepte und Wege selbst gestalten können. Sie brauchen dafür individuelle Lösungen, Entwicklungsspielräume, Supportstrukturen und personelle Ressourcen. Das Medien- und KI-Budget darf nicht gekürzt werden, auch nicht an Grundschulen – gleiche Bildungschancen brauchen gerechte Ressourcen.
Schule gemeinsam transformieren
Digitalität verändert die Welt – und sie verändert das Lernen. Schule im Zeitalter der Digitalität braucht Zeit, Beziehung, Begeisterung und Sinn. Sie braucht Raum für Kreativität, Mut zur Veränderung, eine klare Haltung – und das Vertrauen, dass Wandel möglich ist. Der BLLV steht für eine Bildung, die Kinder und Jugendliche stark macht: für eine Zukunft, die von Unsicherheit und Komplexität, aber auch von Chancen und neuen Möglichkeiten geprägt ist. Lassen wir uns nicht treiben – sondern gestalten wir gemeinsam. Für eine Schule, die Kinder begeistert. Für eine Gesellschaft, die Zukunft kann.
DER BAYERISCHE LEHRER- UND LEHRERINNENVERBAND FORDERT DAHER:
- Professionelle Unterstützung der Schulleitungen, Verwaltungen und Lehrkräfte bzgl. IT- und Datensicherheit durch IT-Sicherheitsbeauftragte und professionelle Schulungsangebote, wie es für andere Behörden längst sichergestellt ist.
- Zeit und Ressourcen für Schul- und Unterrichtsentwicklung, Feedbackkultur, Innovation bereitstellen.
- Feste IT-Betreuer:innen für jede Schule, die mindestens 20 Stunden / Woche vor Ort sind.
- Systembetreuer/innen, ByCS-Administrator/innen und Berater/innen digitale Bildung durch eine ausreichende Zahl von Anrechnungsstunden entlasten und professionell unterstützen.
- Anrechnungsstunden für digitale Zusatzaufgaben (z. B. ByCS, Medienkonzept, DSDZ-Tabletklassen) gewähren
- Verwaltungsaufwand bei der Beantragung von Fördermitteln und bei der Administration aller Systeme (z. B. BayernCloud Schule) minimieren!
- Rechtssicherheit schaffen (Datenschutz und Haftbarkeit)! Außerdem müssen sichere Ressourcen für alle Anwendungsfälle bereitgestellt werden.
- Bereitstellung eines DSGVO-konformen Website-Baukastens für Schulen durch den Freistaat.
- Fortbildungsangebote sowohl quantitativ als auch qualitativ weiter ausbauen und die Nutzung der Angebote möglich machen.
- Digitalisierung als Thema und der Umgang mit Digitalität als Core Practice in allen Phasen der Lehrkräfteausbildung fest verankern und methodisch gut aufbereitet vermitteln.
- Systematische Verankerung von Medienerziehung und Medienbildung ab Klasse 1 in allen Schularten.
- Flexibilisierung von Prüfungsformaten und Kompetenzorientierung fördern.
- KI ohne enge Ressourcenbeschränkungen für Lehrkräfte, Schulleitungen und Verwaltung nutzbar machen – auch zur Unterstützung administrativer Prozesse.
- Entwicklung einer KI-App innerhalb der BayernCloud Schule zur Nutzung durch Lehrkräfte, fallweise durch Schülerinnen und Schüler und für Elternkommunikation.
- Gleichwertigkeit der Lernverhältnisse sichern, indem die Infrastruktur flächendeckend optimiert wird (Glasfaserausbau/Breitbandinternet), auch in Flächenlandkreisen mit vielen kleinen Schulen.
- Bayernweite, datenschutzkonforme Lizenzen für KI-Tools und digitale Anwendungen bereitstellen.
- Verstetigung des Digitalpakts mit fairer, unbürokratischer Mittelvergabe. Die politische Uneinigkeit zwischen Freistaat und Sachstandträger über die Schulfinanzierung darf nicht auf dem Rücken der Schulen und Schulleitungen ausgetragen werden. Alle Lehrkräfte müssen zwingend mit zeitgemäßen Lehrer-Dienstgeräten ausgestattet werden.
- Aufbau von lokalen Supportstrukturen für IT, Didaktik, Medienpädagogik sicherstellen.
- Finanzielle Ausstattung der Grundschulen auf das Niveau der weiterführenden Schulen anheben.
- Geräteausleihe und erhöhte Förderbeträge (z. B. 400 € pro Kind) für Familien mit Unterstützungsbedarf sicherstellen.
Weitere BLLV-Positionen zum Thema Schule und Digitalität: