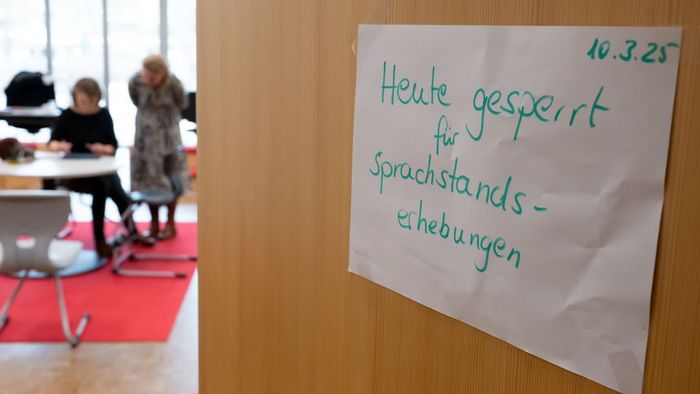Wie die BLLV-Präsidentin in ihrer Einleitung betonte, richtet sich die Kritik aus der Praxis nicht gegen eine „diagnosegeleitete“ Förderung, in der ein Förderbedarf zunächst festgestellt wird und dann eine individuelle Förderung erfolgt. Ganz im Gegenteil betonte sie den großen Stellenwert von Sprachkompetenz und ihrer Förderung für den Zugang zu Bildung und für die Bildungsgerechtigkeit. „Alle sollten sich ganz klar die Frage stellen, was der Test in seiner aktuellen Form für viereinhalbjährige Kinder und ihre Eltern bedeutet. Und wir stellen die Frage, wer angesichts des überall herrschenden Personalmangels dann die Förderung dieser Kinder übernehmen soll“, so Simone Fleischmann.

BLLV-Erfolg nach der Pressekonferenz zu verpflichtenden Sprachstandstests
München – Seit dem Beschluss des Ministerrats Ende 2023 lässt das Thema Grundschulen, Kitas und Eltern nicht mehr los: verpflichtende „Sprachstandserhebungen“ für Schulkinder vor der Einschulung. In seiner Pressekonferenz am 7. April 2025 beleuchtete der BLLV die diagnostischen und bürokratischen Probleme des Konzepts anhand von Erlebnisberichten, konkreten Fällen und der Einschätzung von Expertinnen und Experten. Auf dem Podium vertreten waren die, die nah dran sind am Thema: Schulleitungen, Testende und Verwaltungsangestellte. Auf der Pressekonferenz wurden außerdem die aktuellen Zahlen einer Umfrage unter 273 Testerinnen und Testern vorgestellt, die die Sprachstandserhebungen an den Schulen durchführen. Hier zeigte sich der enorme bürokratische und zeitliche Aufwand besonders deutlich. Ein alarmierendes Ergebnis aus Sicht des BLLV: 45 Prozent der Befragten gaben an, für die Zusatzaufgabe der Sprachtests keine Anrechnungsstunden zu erhalten. BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann betonte dabei allerdings: „Der Aufwand war enorm und es gibt viel Verbesserungsbedarf. Wichtiger ist aber etwas anderes: Es geht darum, förderbedürftige Kinder mitzunehmen und nicht auszugrenzen. Sonst werden wir den Kindern und dem Anspruch, der hinter den Tests steht, nicht gerecht.“ Das Kultusministerium reagierte prompt: Kultusministerin Anna Stolz kündigte gegenüber BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann eine Optimierungsphase an. Es soll mehr Personal und mehr Vorkurse für die förderbedürftigen Kinder geben.
Ihre Einleitung untermauerte die BLLV-Präsidentin mit den Zahlen der Umfrage unter den Testerinnen und Testern der Sprachstandserhebungen, die der BLLV vom 14. März bis zum 2. April 2025 durchführte und an der sich 273 Personen beteiligten: „Im Median testet eine Lehrkraft aktuell rund 59 Kinder – in manchen Regierungsbezirken sogar 80. Und wir wissen von Münchner Schulen, wo von einer Testperson 112 Kinder getestet werden sollen. Die befragten Kolleginnen mussten im Durchschnitt rund elf Ersatztermine zusätzlich anbieten, weil die regulären Termine nicht wahrgenommen wurden. Für diese Testungen erhielten 39 Prozent der befragten Beratungslehrkräfte und 68 Prozent der Schulpsychologinnen keine Anrechnungsstunden, sondern sollen diese Zusatzaufgabe einfach mal quasi nebenbei erledigen. Wir haben die Zahlen aus den Angaben in der Umfrage errechnet und kommen auf 13.000 aufgewendete Stunden von den Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. 90 Prozent der Befragten geben an, dass sie die Testung nicht in der regulären Beratungszeit durchführen, sondern zusätzlich zu ihrer Unterrichtszeit in ihrer Freizeit. Ich möchte dabei betonen: Wir wissen, dass es am Anfang bei einem solchen neuen Thema ruckelt und wir wollen jetzt nicht jammern – darum geht es uns nicht! Aber wir sind gegen Schnellschüsse und reflektieren, was das in der Praxis auslöst.“ Zur Ankündigung der Kultusministerin sagte sie im Nachgang der Pressekonferenz: „Wir freuen uns, dass wir mit den Anliegen der Lehrkräfte und der Schulen im Kultusministerium Gehör gefunden haben und werden sehr genau beobachten, welche Maßnahmen jetzt wirklich ergriffen werden.“
Medienbericht
Praxis-Schock bei den Tester:innen
Katharina Rottler, Beratungslehrerin und 3. Vorsitzende im BLLV Mittelfranken, sowie Silvia Glaser, Leiterin der Fachgruppe Schulberatung im BLLV, kennen die Sprachstandserhebungen genauestens aus der Praxis – und fühlten sich zum Start trotzdem mehr als schlecht vorbereitet, auf das, was auf sie zukam. „Ich habe von Anfang an alles gelesen, was tröpfchenweise bei uns ankam – weil ich gut vorbereitet sein wollte. Und trotzdem kam es im Januar zu einem wirklich unangenehmen Beratungsgespräch mit einer besorgten Mutter. Sie kam mit all den Fragen, den Ängsten und den Sorgen vor den bevorstehenden Sprachstandserhebungen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das Testverfahren noch kein einziges Mal gesehen und kam mir wirklich unprofessionell vor, weil ich keine Antworten auf die Fragen hatte. Einfach deswegen, weil es diese Antworten noch nicht gab“, schildert Katharina Rottler ihren ersten Praxis-Schock. Es sollte nicht der letzte sein, denn die Beratungslehrerin kann viel berichten von schwierigen Schulungen auf dem neuen Testsystem, Daten- und Übertragungsproblemen und nicht zuletzt von Testungen, zu denen die Hälfte der Eltern mit ihren Kindern gar nicht erschienen. Ganz abgesehen von den bei ihr fehlenden Anrechnungsstunden für die Sprachtests, was für die Beratungslehrerin bedeutet, dass sie die Tests in ihrer Freizeit macht. Denn ihre Beratungsstunden sind in dieser Zeit für die Einschulung, für Infoabende und vieles mehr längst verbraucht.
Silvia Glaser fasst ihre Erkenntnisse wie folgt zusammen: Die Tests bedeuten einen riesige Zeitaufwand von rund 45 Minuten pro Test, „aufgeblasen“ durch Bürokratie, ausgefallene Termine, IT-Probleme und vieles mehr – und das für zwanzig, dreißig oder mehr Kinder. Sie betont dabei, dass bis zu 50 Prozent der Termine für die Tests am Ende nicht klappen. Zeit, die dann spontan nur sehr schwer für etwas anderes genutzt werden kann, wenn gleich der nächste Termin ansteht. Und auch sie berichtet davon, dass Anrechnungsstunden für diesen Mehraufwand oft genug schlicht nicht da sind: „Dieser Zeitaufwand geht auf Kosten der Kinder, der Schülerinnen und Schüler und der Testleitungen. Ganz viele Beratungslehrkräfte und Schulpsychologinnen haben für diese Arbeit der Sprachstandstests – übrigens genau wie ich – keine Anrechnungsstunde bekommen. Und das ist der Fakt, der mich am meisten erschreckt.“
Ein Schnellschuss unter dem alle Betroffenen leiden
Sabine Bösl, Leiterin der Abteilung Schul- und Bildungspolitik im BLLV, betont, wie jetzt alle Betroffenen unter dem „Schnellschuss Sprachstandserhebung“ leiden – von Schulen und Kindern bis hin zu Kitas und Schulämtern: „So geht eine professionelle Umsetzung nicht. Das Testverfahren musste innerhalb kürzester Zeit entwickelt werden. Viele Fragen blieben offen, Infos kamen häppchenweise oder zu spät. Das sorgte bei uns in den Grundschulen für viel Verwirrung bei allen Beteiligten. Das System überfordert Kitas, Verwaltungsangestellte, Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen genauso wie Schulleitungen.“
Vor allem betont Sabine Bösl, was sich aus Sicht des BLLV ändern muss, damit sie in Zukunft weniger verängstigte Kinder und Eltern bei den Tests sieht, die am Ende trotzdem keine angemessene Förderung bekommen. Denn es fehlt einfach an qualifizierten Kräften. Es geht laut Bösl um einen Abbau der Bürokratie, eine Vereinfachung und Digitalisierung der Prozesse, einen Ausbau der Kita-Plätze und des Personals sowie eine Stärkung und bessere Einbindung der Kitas bei den Tests – sonst sei das Verfahren in Zukunft einfach nicht tragbar. Nicht zuletzt fordert der BLLV auch ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr, um die rund 7,5 Prozent der Kinder zu erreichen, die derzeit in Bayern keine Kita besuchen.
Die Verwaltung ächzt unter der Bürokratie
Auch Sabine Breitenhuber, Verwaltungsangestellte, und Brigitte Pekarek, ebenfalls Verwaltungsangestellte sowie BLLV Personalrätin München-Land, berichten von komplexer Bürokratie, veralteten Prozessen und enormen Aufwänden – angefangen beim Schriftverkehr per Post und Bescheiden, die per Einschreiben mit Rückschein verschickt werden müssen. „Den Eltern, deren Kinder Förderbedarf haben, müssen wir einen vierseitigen Bescheid in einem Amtsdeutsch zuschicken, das wir erstmal zu zweit Absatz für Absatz lesen mussten, um zu verstehen, was denn jetzt die Eltern als nächstes einreichen müssen. Da geht es ja oft um Kinder und ihre Eltern, die zu Hause nicht so viel Deutsch sprechen und die sollen dann diesen vierseitigen Bescheid verstehen. Und dann kommen die nächsten Bescheide und die nächsten Unterlagen. Und was passiert mit den Eltern, die bis September nachweisen müssen, dass sie trotz ihrer Bemühungen keinen Kindergartenplatz bekommen konnten? Wie soll man mit mangelnden Deutschkenntnissen ausführlich begründen, dass man sich ordentlich bemüht hat, einen Kindergartenplatz zu bekommen und den nicht erhalten hat?“, fragt Sabine Breitenhuber.
Sehr ähnliche Erfahrungen machte Brigitte Pekarek: „Wir mussten per Post alle Eltern für den Jahrgang anschreiben. Papierkrieg ohne Ende und auch der Gang zur Post war sehr zeitaufwändig. Hier würde ich mir wünschen, dass wir nur die Eltern anschreiben, die laut Kindergarten einen Förderbedarf haben. Ich kann Ihnen dazu eine konkrete Zahl geben: Wir haben zwölf Kinder getestet. Dafür habe ich 100 Anschreiben per Post rausgeschickt. Das Ergebnis waren dann sieben Kinder, die den Test nicht bestanden haben und sich jetzt um einen Kindergartenplatz und eine Förderung kümmern müssen. Ich finde, der Arbeitsaufwand steht in keiner Relation.“
Besser werden für die Kinder
Am Ende betonte BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann: „Es geht nicht nur um eine Veränderung des Testzeitraums. Es geht nicht nur um bessere Vorlaufzeiten. Es geht nicht nur darum, dass wir die Kinder testen, sondern es geht vor allem darum, dass es Menschen gibt, die diese Kinder dann auch in vernünftigen Rahmenbedingungen fördern können. Wir bieten unsere weitere Kooperation an, um gemeinsam daran zu arbeiten. Alle von uns im BLLV, die auf unterschiedlichen Ebenen Profis aus der Praxis sind, gehen gerne weiterhin in den Dialog. Wir wollen zur Professionalisierung beitragen. Denn so kann es nicht bleiben.“
Sprachstandserhebungen: BLLV-Umfrage offenbart zahlreiche Schwächen in Umsetzung durch Kultusministerium
Sprachstandstests in der Praxis - Ein Kommentar von Silvia Glaser, Leiterin der Fachgruppe Schulberatung im BLLV

“Gut gemeint, völlig überstürzt umgesetzt”
Eine Befragung des BLLV unter den Testleitungen im März und April 2025 zeigt erschreckend deutlich die Probleme auf, die rund um die Sprachstandstests entstehen, meint Silvia Glaser, Leiterin der Fachgruppe Schulberatung im BLLV.
Gefragt waren all diejenigen in Bayern, die als Testleitung Sprachstandserhebungen in den Grundschulen durchführen sollten. An der bayernweiten Umfrage des BLLV haben 273 Personen teilgenommen, davon 211 Beratungslehrkräfte sowie 62 Schulpsycholog*innen. Abgeglichen mit Angaben des Kultusministeriums machen die Befragten etwa ein Viertel aller geschulten Testleitungen in Bayern aus.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Umfrage sollten insgesamt 18.510 Sprachstandserhebungen durchführen. Die hohe Beteiligung der Testleitungen an der BLLV-Umfrage zeigt eindeutig, dass in der Praxis der Schuh massiv drückt.
Erstes Problem: Zeitausgleich fehlt
Laut Ministeriums wurden für die Durchführung der Tests sogenannte Anrechnungsstunden vergeben (d. h. Arbeitszeit speziell für die Sprachstandstests). Doch diese decken in der Praxis nur einen Teil der aufgewendeten Zeit ab, wie unsere Erhebung belegt. Von den teilnehmenden Testleitungen erhielten knapp die Hälfte (45%) keine einzige Anrechnungsstunde. Aufgegliedert nach Profession gingen 39% der befragten Beratungslehrkräfte und 68% der Schulpsycholog*innen leer aus.
Zudem ist es für die Kolleginnen und Kollegen der Schulberatung nur schwer möglich, teils langfristig vereinbarte Beratungstermine und die eigene Unterrichtsverpflichtung einfach zurückzufahren. Die Folge: Die Testleitungen führten viele Sprachstandstests in ihrer Freizeit durch. Nach Schätzungen der Befragten waren es über die durch Arbeitszeit abgedeckten Stunden hinaus ganze 4.207 Zeitstunden ihrer Freizeit, die die 273 Kolleginnen und Kollegen für Sprachstandstests insgesamt aufbrachten. Auf alle Testleitungen, nicht nur die Teilnehmer*innen der Befragung, hochgerechnet, könnten das bayernweit alleine in diesem Jahr 16.800 Stunden an investierter Freizeit der Beratungsfachkräfte sein.
Zweites Problem: Die vielen Ersatztermine
In der Planung wird pro Kind mit einem Testtermin gerechnet. In der Praxis jedoch zeigte sich, dass 16% aller Termine gar nicht erfolgreich zu einem Test geführt haben. Die Familien sind oft unentschuldigt nicht erschienen oder die Eltern haben ihr Kind gar nicht mitgebracht, weil sie das Anschreiben nicht verstanden haben. Damit entstanden den qualifizierten Beratungslehrkräften und Schulpsycholog*innen Wartezeiten bis zum nächsten Sprachtest, die nicht sinnvoll nutzbar waren. Die aufgewendete Zeit ging verloren – und zusätzlich mussten die befragten Testleitungen nach eigenen Angaben 2.993 Ersatztermine vergeben. Im Mittel kommt eine Testleitung somit auf rund 11 Ersatztermine. Jeder Ersatztermin kostet nochmal Zeit.
Drittes Problem: Unterrichtsausfall
Darüber hinaus gehen die Sprachtests auch auf Kosten der Schülerinnen und Schüler an Grund- und Mittelschulen. Offiziell soll aufgrund von Sprachstandserhebungen kein Unterricht ausfallen. Die Wahrheit aber sieht auch hier ganz anders aus, wie die Umfrage zeigt: Die Befragten gaben an, dass zahlreiche ihrer Unterrichtsstunden wegen der Sprachstandserhebungen gestrichen oder vertreten werden mussten. Besonders bitter: Entfallen sind nach Aussagen der Befragten teilweise auch Förderstunden für sprachschwache Kinder und DaZ-Stunden (Deutsch als Zweitsprache).
Viertes Problem: Die „Logo-Kinder“
Welche Aspekte gehören denn eigentlich dazu, wenn mit BaSiS der Sprachstand der bayerischen Kinder gemessen wird? Logopädische Schwierigkeiten jedenfalls nicht. Deshalb haben die zahlreichen Kinder, die mit Auffälligkeiten in diesem Bereich geschickt wurden, den Test auch alle bestanden. Ein unnützer Verbrauch von Ressourcen. Im nächsten Schuljahr muss deshalb unbedingt Klarheit her, dass Kinder „nur“ wegen logopädischer Probleme nicht zum Sprachtest in die Grundschule müssen, weil der Test diesen Aspekt gar nicht misst.
Fünftes Problem: Mieser erster Eindruck von Schule
Einladung per Brief im Amtsdeutsch, Einbestellung zum Testen, Leistungsdruck. Und wer zweimal nicht kommt, dem droht Bußgeld. Dass viele Kinder und auch deren Eltern eingeschüchtert, oft ängstlich, mindestens aber sehr verunsichert und nervös zum Sprachstandstest kommen, ist keine Überraschung. Dieser oft sehr negative erste Eindruck von Schule brennt sich bei Eltern und Kindern ein. Und für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
Sechstes Problem: Wozu eigentlich Sprachstandstests?
Eine Frage muss bei der Evaluation im Vordergrund stehen: Wozu soll dieser ganze Aufwand jetzt eigentlich dienen? Diagnostik macht immer nur dann Sinn, wenn sich eine wirksame Förderung anschließt. Die Kinder mit Bedarf brauchen ein entsprechendes Angebot an Vorkursen in unmittelbarer Umgebung und ausgestattet mit qualifiziertem Personal. Solange das nicht sichergestellt ist, macht auch die Testung wenig Sinn. Doch beim Blick auf die notwendigen Vorkurse spricht das Kultusministerium bisher nur sehr unverbindlich von einem „sukzessiven Ausbau“.
Fazit: Gut gemeint, völlig überstürzt umgesetzt.
Politisch wurde durchgedrückt, dass die Tests unbedingt schon ab diesem Schuljahr durchgeführt werden. Die Hau-Ruck-Einführung geschah dabei wissentlich gegen die Empfehlung des BLLV und vieler weiterer Experten aus der Praxis, die für einen längeren Vorlauf und ein überlegteres Vorgehen plädierten.
Die Belastung tragen nun die Kinder und deren Eltern, die Mitarbeiter*innen an den Kitas, die Beratungslehrkräfte und Schulpsycholog*innen, die Schulleitungen und die Verwaltungsangestellten. Die Umsetzung ist unzureichend organisiert, geht auf Kosten der Freizeit der Kolleginnen und Kollegen, verunsichert Kinder und Eltern schon vor dem Eintritt in die Schule und führt noch nicht mal gesichert zur nötigen Förderung.
Vertan wurde damit die einmalige Chance, dass Sprachstandstests in der Praxis positiv gesehen werden, denn dafür hätte es Bedacht mit Vorlauf, Strategie und entsprechenden Ressourcen gebraucht. Bleibt zu hoffen, dass vom Ministerium jetzt ehrlich evaluiert wird, Konsequenzen gezogen und für das nächste Schuljahr die größten Probleme rund um die Sprachtests ausgeräumt werden. Wir sind gesprächsbereit.
Silvia Glaser, Leiterin der Fachgruppe Schulberatung im BLLV
Kontakt: schulberatung(at)bllv.de
Weitere Medienberichte
Simone Fleischmann im Wortlaut in der SZ:
„Schade, dass ein so pädagogisch wertvolles Instrument so in den Sand gesetzt wird.“
„Wir beschuldigen keine Testentwickler, wir beschuldigen nicht das Kultusministerium. Es geben alle mehr als machbar ist.“
„Wir sind gegen Schnellschüsse und dagegen, dass der Ministerpräsident sich ganz schnell ein pädagogisches Instrument überlegt und dann damit Wahlkampf macht, dass Kinder, die kein Deutsch können, nicht in die Schule gehen sollen."
Weitere Meldungen: Donaukurier | Main-Echo | Main-Post | Süddeutsche | WELT | Antenne Bayern | Augsburger Allgemeine | Passauer Neue Presse | Traunsteiner Tagblatt | Fränkische Landeszeitung | Borkener Zeitung | OVB Heimatzeitungen | Straubinger Tagblatt