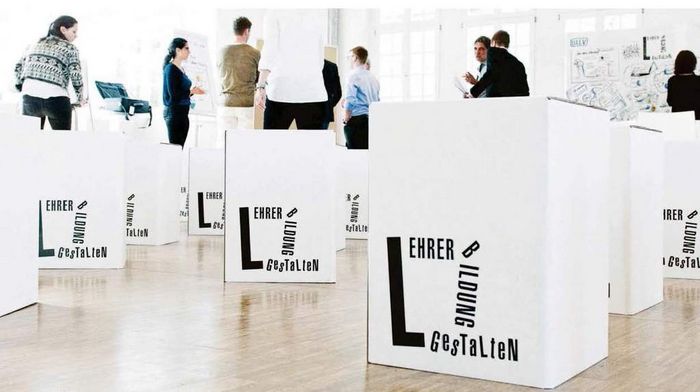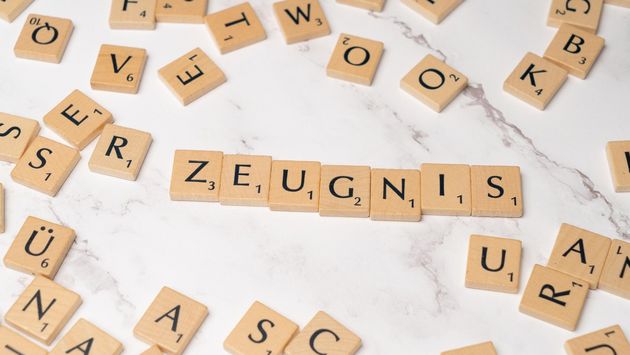„Wer B sagt, muss auch A sagen“, so begrüßte Simone Fleischmann die Teilnehmenden des Fachgesprächs zur Lehrkräftebildung, das kurz vor Schuljahresende in der Geschäftsstelle des BLLV stattfand. Und damit war der BLLV-Präsidentin kein Versprecher unterlaufen. Denn sie führte aus: Wer durch die Einführung von A13 die ungleiche Besoldung löst, also „B sagt“, müsse jetzt auch das Davor, die Ausbildung angleichen. So fordert das auch Prof. Dr. Martin Huber, Vorsitzender der Expertenkommission mit 10 gemeinsamen Semestern für alle Lehrkräfte. Fleischmann lobt deren Arbeit und spornt an: „Die Verbesserung der Lehrerbildung ist seit Jahrzehnten ein großes Anliegen für den BLLV: Jetzt muss Veränderung geschehen!“

Chance jetzt nutzen!
Wie geht zukunftsweisende Lehrkräftebildung in Bayern? Dazu tauschte sich die Expertenrunde des Fachgesprächs "Innovative Lehrerbildung in Bayern gestalten" aus. Eines wird klar: Die Zeichen stehen gut für Veränderung.
Ein besonderes Engagement des BLLV zur Verbesserung der Lehrerbildung ist der seit 1987 im zweijährigen Rhythmus ausgelobte Pädagogikpreis. Wie innovative Lehrkräftebildung geht, zeigten deshalb zwei Siegerprojekte beim Fachgespräch: Prof. Dr. Anita Schilcher und Team (Universität Regensburg) sowie PD Dr. Karoline Hillesheim mit Dr. Kathrin Gietl (Universität Augsburg).
Uni Regensburg: Core Practices wichtig für Basiskompetenzen von Studierenden
In ihrem Vortrag zum Gewinnerprojekt „Core Practices als Schlüssel für den Theorie-Praxis-Transfer“ monierte Prof. Dr. Anita Schilcher, dass Fachwissenschaft in Forschung in Bayern nicht gut eingebunden sei. Leider bekämen Studierende in der ersten Phase nicht die Basiskompetenzen vermittelt im Studium, die sie bräuchten. Core Practices versprächen hier Abhilfe: Sie würden in Lehre, Publikationen und Forschung und Praxisprojekten eine wichtige Rolle spielen.
Uni Augsburg: Wichtige Kommunikationssituationen simulieren – gestützt von KI
Dass gelungene Elterngespräche kein Zufall sind, stellte PD Dr. Karoline Hillesheim klar. Vielmehr sei das Rüstzeug für diese besondere Kommunikationssituation erlernbar. Durch ihr Projekt will sie Studierenden dabei helfen – unterstützt durch KI.
Bislang sei es so, dass von Eltern und Lehrkräften gleichermaßen Gespräche miteinander als stressig empfunden würden. Bereits für Studierende zeige sich die Zusammenarbeit mit den Eltern als Stressfaktor. Sie appellierte, dass diese aber ein zentrales Aufgabengebiet für Lehrkräfte sei. Sie entscheide auch über die Zukunft von Kindern, beispielsweise ob ein Kind entsprechende Förderung bekomme oder eben nicht. Ein gutes Elterngespräch sei deshalb nicht Kür, sondern Pflicht!
Prof. Dr. Martin Huber, Sprecher der Vizepräsidenten für Lehre der bayerischen Universitäten und Vorsitzender der Kommission, gab Einblick in die Arbeit der Expertenkommission. Er plädiert dafür, dass man sich ein Beispiel an dem Medizinstudium nehmen sollte: Man sollte sich auf einen Katalog von Kompetenzen verständigen, die Studierende nach einer bestimmten Zahl von Semestern erworben haben sollten.
Expertenkommission empfiehlt: Veränderungen in der Lehrkräftebildung nur sinnvoll, wenn alle drei Phasen im Blick sind und eine sinnvolle Verzahnung dieser stattfindet
Huber führt weiter aus, dass während der Kommissionsarbeit klar wurde, dass man sich nicht, wie ursprünglich gedacht, nur auf die erste Phase der Lehrkräfteausbildung konzentrieren kann, sondern dass man alle drei Phasen im Blick haben muss. Fokus müsse dabei auch sein, wie man diese Phasen sinnvoll miteinander verknüpfen könne. Wichtig sei es auch, dass auch die Seminarschulen auf diesem Weg der Veränderung mitgenommen werden müssten, also eine Verzahnung von erster und zweiter Phase der Lehrkräftebildung angesagt sei.
Expertenkommission empfiehlt: Staatsexamen braucht mehr Praxisbezug
Fachwissenschaft und Fachdidaktik zusammenzubringen sei eine wichtige Frage auch in der Expertenkommission gewesen, so Huber. Im Gutachten fordere man zehn Semester für alle. Es werde außerdem ein kumulativer Kompetenzerwerb empfohlen und ein noch stärkerer Professionsbezug.
Zwar sei das Staatsexamen gesetzt – es müsse aber reformiert werden und brauche eine neue Prüfungskultur: ein hoher Praxisbezug sei nötig. Um hier zu Veränderung zu kommen, sei eine Zusammenarbeit mit Ministerien und Administration unabdingbar. Huber betont, dass Vernetzung wichtig sei in der Lehrkräftebildung, ebenso wie die Schulforschung.
Ein riesiger Erfolg für mehr Bildungsqualität: Reformvorschläge müssen jetzt umgesetzt werden!
Die nächsten Schritte für die BLLV-Politik
Prof. Dr. Huber kritisiert, dass nach Veröffentlichung des Berichts der Kommission ein völlig intransparenter Prozess gefolgt sei. Für Veränderung brauche es aber Dialogizität. Dialog mit der Wissenschaft sei entscheidend. Deshalb plant er jetzt eine große Tagung von Seiten der Wissenschaft und lädt den BLLV dazu ein.
Januar 2026 soll der Masterplan mit den Ergebnissen der Kommission ins Kabinett gehen. „Der Auftrag für die Expertenkommission kam von oben, ausgelöst durch die Gleichwertigkeitsdiskussion. Das Erarbeitete darf jetzt nicht versanden: Lehrerbildung muss sich ändern!“, appelliert BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.
BLLV-Abteilungsleiterin Antje Radetzky vergleicht die Situation des Staatsexamens mit den Prüfungen an der Schule; es fände ein „learning for the test“ anstatt eines „learning for life“ statt. Hier müsse insgesamt ein Umdenken stattfinden hin zu einem nachhaltigen und vernetztem Lernen stattfinden, eben nicht nur lernen für den Abschluss.
Nina Pirc, Referendarin und ehemals Vorstandsmitglied der Studierenden im BLLV, regt eine bessere, an Veränderung orientierte Zusammenarbeit mit den Seminarschulen an. Das Gutachten sollte bis Januar mit den Seminarleiter*innen durchgesprochen werden und ein Konsens gefunden werden. Seminarlehrer und Seminarschulen müssten dazu genommen werden.
Auch Simone Fleischmann ist der Meinung, dass, wenn die 13 Bausteine der Kommission umgesetzt werden sollen, klar ist, dass sich die zweite Phase der Lehrkräftebildung ändern muss. Die Seminarleiter*innen müssten dringend in diesen Prozess integriert werden, um Widerstände aufzuheben.
Lena Schäffer, 1. Vorsitzende der Studierenden im BLLV, stellt im Bericht der Kommission die positive Fehlerkultur heraus. Die positive Fehlerkultur müsse auch Einzug in die Lehrkräftebildung erhalten. Zudem hält sie es für sehr zielführend, den Bericht in kurz-, mittel- und langfristigen Forderungen einzuteilen und diese Forderungen auf die Agenda zu setzen. Sie fordert auch, dass man sich das Hochschulinnovationsgesetz noch einmal genau anschaut und guckt, wo Bildung noch einmal besser finanziell gefördert werden könne. Gerade hinsichtlich der Forschung, die aktuell sehr auf den naturwissenschaftlichen Bereich konzentriert ist.
Dass auch Gesellschaft und Eltern in diesem Prozess mitgenommen werden müssen, gibt Birgit Dittmar-Glaubig (ehem. Leitern der Abteilung Berufswissenschaft im BLLV) zu bedenken. Veränderungen in der Lehrerbildung würden auch Auswirkungen auf sie haben.