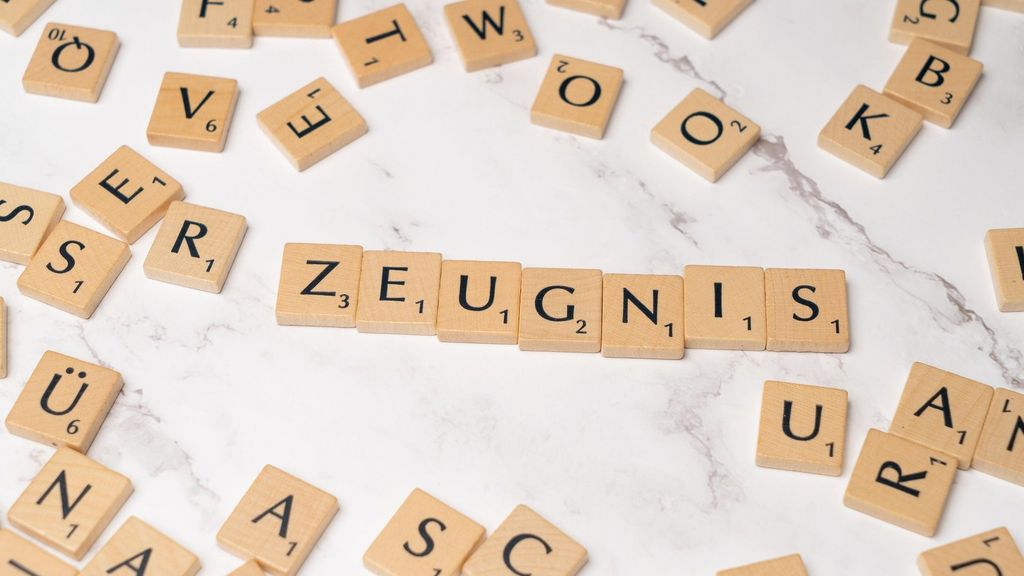Planungssicherheit statt Schlingerkurs
Die Schulen haben sich im vergangenen Schuljahr mit großem Engagement den Herausforderungen der Digitalisierung gestellt – trotz widriger Rahmenbedingungen. Antje Radetzky, Schulleiterin und Leiterin der Abteilung Berufswissenschaft im BLLV: „Positiv bewerten wir das jüngste Kultusministerielle Schreiben (KMS) zur Rolle der Systemadministrator:innen, das endlich über die eigentlichen Zuständigkeiten aufklärt. Doch ein Rollenpapier ersetzt keine Ressourcen. Viele Sachaufwandsträger berufen sich weiterhin auf den Städtetag und verweisen auf das Kultusministerium als zuständig – und umgekehrt. Die Aufgaben der Systemadministrator:innen und die Zahl der Geräte vor Ort sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Dazu kamen Aufgaben im Zusammenhang mit der Plattform „BayernCloud Schule“ (ByCS), dem Bayerischen Lesescreening (BYLES), den neuen Sprachstandstests (BaSiS) und vieles mehr - die Anzahl der Anrechnungsstunden blieb jedoch gleich.“
Wie Antje Radetzky erläutert, gibt es außerdem weiterhin eklatante Lücken in der Ausstattung: „Ersatzteile für Lehrerdienstgeräte sind nicht förderfähig und Software sowie Lizenzen bleiben oft unberücksichtigt – auch, weil sie in kommunalen Haushalten nicht eingeplant wurden. Der BLLV fordert hier gezielte Nachsteuerung: Nachhaltigkeit heißt auch Wartung, Support und Fortbildung. Viele Kollegien kämpfen mit großen Netzwerken und komplexer Technik – ohne ausreichende personelle Entlastung.“
Finanzierung mit Weitblick – auch bei der Digitalisierung
„Als positives Signal werten wir das neue KI- und Medienbudget, das jeder Schule zur Verfügung steht“, so Radetzky weiter, allerdings schränkt sie ein, dass die Mittel knapp bemessen sind. Jede Schulleitung muss selbst entscheiden, welche Tools angeschafft werden sollen. Besonders für Grund- und Mittelschulen mit dünner Personaldecke und fehlenden Fachschaften bedeutet das eine hohe Belastung. Lehrkräfte, die die Schule wechseln, müssen sich oft in völlig neue Systeme einarbeiten – auch das kostet Zeit und Energie, die im pädagogischen Alltag fehlt.
Nicht zuletzt bereitet auch die Ausstattung der Lehramtsanwärter:innen Probleme: Viele erhalten ihre Ausbildungsgeräte sehr spät, manche dann nach dem Start des Schuljahres erst im Oktober und diese funktionieren dann teils erst im Januar. „Nach Aufklärung durch Datenschutzbeauftragte nutzten viele ihre Geräte dann gar nicht mehr – aus Sorge, etwas falsch zu machen. Der ursprünglich von den Seminarschulen übernommene Weg passt nicht zu den Grund- und Mittelschulen. Hier wäre eine Ausstattung mit einem Lehrerdienstgerät der Stammschule deutlich praxistauglicher und besser kompatibel mit den Gegebenheiten vor Ort“, erläutert BLLV-Expertin Radetzky.
Verunsicherung durch den Kurswechsel der Staatsregierung bei der Digitalisierung
Zusätzliche Verunsicherung brachte der abrupte Kurswechsel bei der „Digitalen Schule der Zukunft“. Das ambitionierte Leuchtturmprojekt wurde im Juni deutlich zurückgefahren: Tablets sollen nun erst ab Jahrgangsstufe 8 eingesetzt werden – entgegen der ursprünglichen Planungen. Viele Schulen, die bereits medienpädagogisch fundierte Konzepte entwickelt und umgesetzt haben, sehen sich damit ausgebremst. Dennoch gilt: Viele haben sich auf den Weg gemacht, vieles funktioniert – mit dem Mut der Schulen und dem Know-how der Lehrkräfte.
Der BLLV fordert, dass die Schulen für diesen Einsatz nicht weiter gebremst werden. Was es braucht, sind: verlässliche Zuständigkeiten, langfristige Planungssicherheit und gezielte Förderung. Lehrerinnen und Lehrer zeigen tagtäglich, dass Digitalisierung gelingen kann – wenn man sie denn lässt.
Streit um 1:1-Ausstattung mit digitalen Endgeräten: Schulen brauchen Vertrauen statt Verbote
Im aktuellen Schuljahr konnten alle staatlichen Schulen mit zwei Jahrgangsstufen der Sekundarstufe mit dem 1:1-Ausstattungsprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ starten. Ziel war es, alle Schüler:innen mit einem digitalen Endgerät auszustatten, wobei der Freistaat bis zu 350 EUR pro Gerät erstattete. Für die Schulen bedeutete dies eine große Herausforderung, da pädagogische Konzepte, Fortbildungen, Elternarbeit, technisches Know-how und verändertes Klassenmanagement notwendig waren. Dennoch meisterten viele Schulen diese Anforderungen mit großem Engagement.
Besonders wichtig ist: Weder Lesen, Handschrift noch Schreiben wurden dadurch vernachlässigt. Vielmehr gelang es den Schulen, klassische Bildungsinhalte sinnvoll mit der digitalen Lebenswelt der Schüler:innen zu verbinden und so einen modernen, ganzheitlichen Unterricht zu gestalten.
Eigenverantwortlichkeit der Schulen bei der Digitalisierung
„Trotz dieser positiven Entwicklungen stoppte Ministerpräsident Söder Anfang Juni unerwartet die weitere Ausstattung unterhalb der 8. Jahrgangsstufe und äußerte pauschale Kritik an der Digitalisierung. Eine Ausnahme werden so genannte ‘Profilschulen‘ sein, die noch definiert werden müssen und für die die Regelung unterhalb der 7. Jahrgangsstufe gilt. Viele Beteiligte fühlten sich dadurch vor den Kopf gestoßen und verunsichert. Dabei ist unbestritten, dass es in neuen Projekten Anlaufschwierigkeiten gibt – diese müssten jedoch durch gezielte Unterstützung und nicht durch Verbote behoben werden“, so Felix Behl, Leiter des Referats Digitalisierung im BLLV.
Der BLLV fordert, dass Schulen weiterhin eigenverantwortlich entscheiden können, ab welcher Jahrgangsstufe sie die 1:1-Ausstattung umsetzen. Ein generelles Verbot für die Unterstufe ist ebenso falsch wie eine verpflichtende Einführung ab Klasse 5. Entscheidend ist, dass Schulen vor Ort selbst über den besten Zeitpunkt entscheiden dürfen. Zugleich fordert der BLLV zusätzliche Zeitressourcen für die Lehrkräfte, die diese Entwicklung federführend begleiten – besonders, wenn sie neben ihren Unterrichtsaufgaben auch organisatorische Aufgaben wie die Antragsprüfung übernehmen.
» Zur Themenübersicht