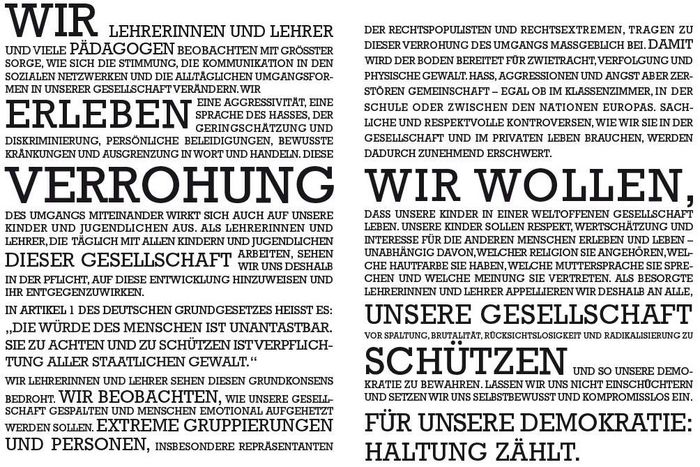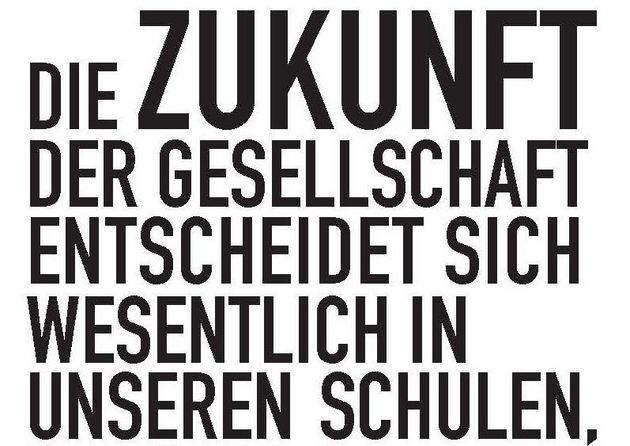“Zehn Jahre Flüchtlingssommer” und „Unsere Lehrer waren nullkommanull darauf vorbereitet“. So überschreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ) in einem ausführlichen, ergreifenden und persönlichen Bericht das, was sich vor zehn Jahren in Deutschland und in Bayern zugetragen hat. Schon im Frühjahr 2015 kamen Flüchtlinge in Deutschland und in Bayern an, suchten Schutz vor Armut und Krieg in Syrien, Afghanistan oder dem Irak. Untergebracht wurden sie am Anfang oft in Turnhallen wie im Poinger Schulzentrum, wo BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann damals die Grund- und Mittelschule leitete.
Eine Perspektive für Geflüchtete und die Kinder
Im Sommer und im Herbst 2015 kamen dann Tausende am Münchner Hauptbahnhof an. Die Bilder in den Medien zeigten immer wieder Gruppen von Geflüchteten, die – von der Polizei begleitet – irgendwo in Bayern über Wiesen und Feldwege liefen. Und natürlich sollten die Kinder in die Schulen, sollten Deutsch lernen und irgendwie ankommen. Gerade den Lehrerinnen und Lehrern war klar, dass die Sprache und der Austausch das wichtigste sein werden, damit die Kinder und alle Geflüchteten irgendwie ankommen, weitermachen können.
Zu Beginn erlebte Simone Fleischmann „eine Willkommenskultur, dass mir das Herz aufging“, wie sie der SZ im Gespräch sagte. Lehrkräfte sammelten Stifte, Hefte und Bücher wo sie sie bekommen konnten und kauften das Material zur Not einfach selbst. Die Kinder an ihrer Schule wollten die “Neuen” kennenlernen, sie in der Klasse haben und ihre Plüschtiere mit ihnen teilen. „Das ging rasant", erinnert sich die BLLV-Präsidentin. „Die Eltern haben mir die Bude eingerannt und wollten unbedingt Deutschkurse geben – ich wusste teilweise gar nicht, wo ich mit der ganzen Hilfe hinsollte“. Schon alleine deshalb war Simone Fleischmann überzeugt, dass das alles bewältigt werden kann.