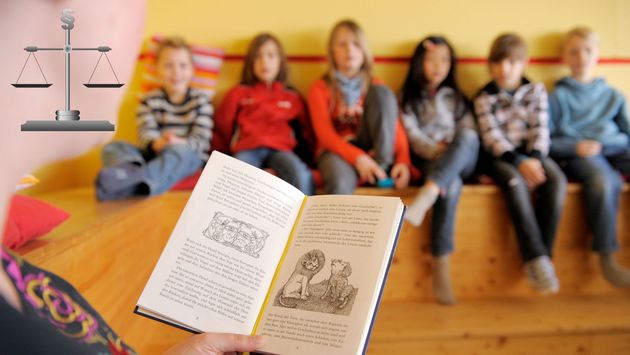In einem Bericht über den gebundenen Ganztag in Bayern beschreibt die Süddeutsche Zeitung, dass die Zahl der Schulen mit gebundenem Ganztag in den letzten Jahren zurückgegangen ist und bezeichnet dies als „das schleichende Ende eines pädagogischen Erfolgsmodells“. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), bedauert diese Entwicklung. Ihrer Ansicht nach werde „ein exzellentes pädagogisches Modell, das in anderen Ländern wie Schweden, Frankreich oder Dänemark super funktioniert und ein neues Lernen ermöglicht, durch die Ganztagsgarantie kaputt gemacht“.
Vieles spricht für den gebundenen Ganztag
Simone Fleischmann kennt die Vorteile des gebundenen Ganztags sehr genau. Als langjährige Schulleiterin einer Grund- und Mittelschule hat sie vor einigen Jahren den gebundenen Ganztag an ihrer Schule eingeführt. Möglich war dies einerseits durch die hohe Förderung durch den Freistaat und die Gemeinde, andererseits durch die Zusammenarbeit mit externen Anbietern wie Sportvereinen und Musikverbänden. Der Zeitung berichtet sie, dass der damalige Slogan „Zeit für mehr“ hervorragend zum Ganztagsangebot an ihrer Schule gepasst habe und konkretisiert, was das für den Schulalltag bedeutete: „Zeit für mehr Förderung, Zeit für mehr Inhalte, Zeit für mehr Persönlichkeitsbildung.“
Gemeinsam mit dem BLLV macht sie sich auch heute für dieses Modell stark und betont, „dass der gebundene, rhythmisierte, professionell mit Lehrerinnen und Lehrern und ergänzend mit externen Experten ausgestattete Ganztag das Gelbe vom Ei ist“. Sie berichtet über die Erfahrungen an ihrer damaligen Schule: „Kinder, die zusammen in einem Projekt am Dienstagnachmittag sind. Es war klar, da geht Lernen anders. Da sind Leute, die wollen offenen Unterricht, die wollen offenes Lernen, die wollen projektorientiertes Lernen, mehr als Schulaufgaben. Ich war euphorisch – und die Leute waren es alle.“
Sie ergänzt, dass der gebundene Ganztag nicht automatisch Wunder vollbringt, beispielsweise bei Kindern mit Sprachförderbedarf oder mit Benachteiligung aufgrund ihrer sozioökonomischen Herkunft, „aber wir hatten Kinder, die mehr aus dieser Zeit mitgenommen haben als einen Zweier in Mathe. Selbstbewusstsein, musikalische Kompetenzen, Auftritt.“
Finanzielle Herausforderungen, Raumnot und Lehrkräftemangel
Die Ursachen für den Rückgang gebundener Ganztagsformen sieht die Süddeutsche Zeitung in der schrittweisen Umsetzung der Ganztagsgarantie an Grundschulen. Bis zum Schuljahr 2029/30 rechne man laut SZ mit 130.000 zusätzlichen Ganztagesplätzen. Hierfür werden zusätzliche Räumlichkeiten und Betreuungspersonal benötigt. Diese Entwicklung belaste die ohnehin klammen Kassen der Kommunen. Dass man die gebundene Ganztagsschule unter diesen Umständen nicht mehr anbieten kann, kann Fleischmann gut nachvollziehen: „Ich kann jeden Schulleiter verstehen, der sagt, was man den Eltern und Kindern verspricht, kann man unter den Rahmenbedingungen nicht halten“. Dennoch kritisiert sie, dass man die Pädagogik nun hintenanstelle – hinter dem Zwang, Betreuungsräume und -personal bereit zu stellen.
Sie bestätigt, dass der Lehrkräftemangel ein entscheidender Faktor beim Ausbau des Ganztags ist: „Jetzt haben wir Lehrkräftemangel und nicht mal mehr vor jeder Klasse im Pflichtunterricht eine Lehrerin oder einen Lehrer.“ Seit langem weist der BLLV auf den eklatanten Lehrkräftemangel im Freistaat hin. Auch dass die Räumlichkeiten an Schulen viel besser an die Anforderungen des Ganztags angepasst werden müssten, ist ein bekanntes Thema. Wenn die Kinder und Jugendlichen vier Mal pro Woche acht Stunden in der Schule verbringen, braucht es anstatt der üblichen Klassenzimmer viel eher gut durchdachte Lern- und Lebensräume, beispielsweise offene Raumkonzepte mit Rückzugsmöglichkeiten für Schüler:innen und Lehrkräfte.
Zur Finanzierung der Ganztagsangebote durch die Kommunen, äußert sich Fleischmann kritisch: „Man hat ja gemerkt, dass das ein Rohrkrepierer wird, dass die ganzen Förderungen auf Bundesebene, die Gelder und die Ansagen auf Bundesebene nicht unten ankommen“. Aus ihrer Sicht müsse man die Kommunen besser integrieren, sonst „bleiben sie immer auf den Finanzen hocken“.
Trotz der Kritik am Garantieanspruch, stellt Fleischmann klar: „Wir haben diesen Kick gebraucht, damit man in Bayern merkt, dass die Mami nicht mehr um eins zu Hause mit der Suppe wartet.“