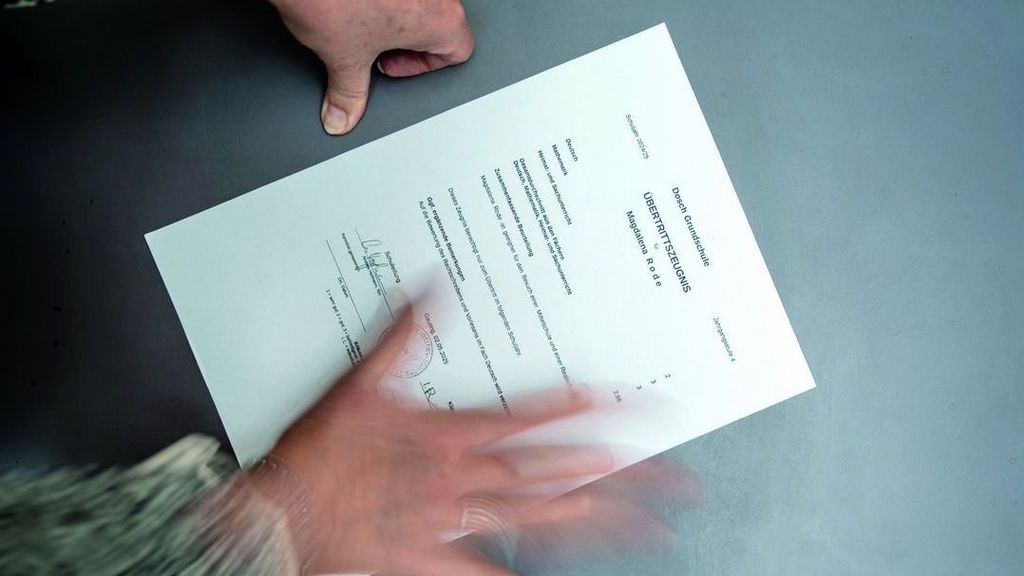Der Fall
Ein Mitglied des BLLV ist Schulleiterin einer Grundschule. Sie hat ein Anwaltschreiben erhalten. Eine Schülermutter hat sich einen Rechtsbeistand genommen und gegen das
Übertrittszeugnis Widerspruch eingelegt. Der eingereichte Widerspruch enthält zunächst keine Begründung. Erst auf eine entsprechende Aufforderung hin wird mitgeteilt, es
seien bestimmte Aspekte des Nachteilsausgleichs nicht erfüllt worden.
Die Rechtslage
Ein Übertrittszeugnis ist, ebenso wie ein Jahreszeugnis, ein Verwaltungsakt und damit anfechtbar. Entscheidend dafür ist der sogenannte „Regelungscharakter“. Offiziell lautet
die Formulierung im Art. 35 BayVwVfG (Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz): „Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.“
Die Behörde ist in diesem Fall die Schule; der Einzelfall ergibt sich, weil jedes Kind sein individuelles Zeugnis erhält; und die Rechtswirkung nach außen ist die erteilte oder versagte Berechtigung des Übertritts an die gewünschte Schulart. Ein Zeugnis enthält, anders als zum Beispiel ein Beihilfebescheid, keine Rechtsbehelfsbelehrung, die eine
Frist von (i.d.R.) einem Monat (§ 70 Abs. 1 VwGO – Verwaltungsgerichtsordnung) zur Anfechtung festlegt. Daher beträgt die Frist in diesem Fall ein ganzes Jahr.
Zuständigkeit
Da der eingereichte Widerspruch des Anwalts an die Schule zunächst keine Begründung enthielt, musste auf Seiten der Schule nichts geschehen. Aber auch danach ist die
Schule nicht zuständig, sollte man dem im Widerspruch vorgebrachten Anliegen nicht nachkommen wollen. Will die Behörde dem Anliegen aus dem Widerspruch nachkommen,
das Übertrittszeugnis also abändern, sodass der gewünschte Schnitt erreicht wird, spricht man davon, dem Widerspruch „abzuhelfen“. Dies kann die Behörde, also die
Schule, selbst tun.
Will man das nicht, ist die nächsthöhere Behörde zuständig. Im Fall einer Grund- oder Mittelschule ist es das Schulamt, bei Förderschulen die Bezirksregierung und im Bereich Realschule / Gymnasium ist es die MB-Dienststelle. Dies ergibt sich aus § 73 Abs. 1 Ziffer 1 VwGO: „Hilft die Behörde dem Widerspruch nicht ab, ergeht ein Widerspruchsbescheid. Diesen erlässt (…) die nächsthöhere Behörde, soweit nicht durch Gesetz eine andere höhere Behörde bestimmt wird (…)“.
Was hat die Schule zu tun?
Die Schulleitung wollte dem Widerspruch nicht abhelfen, daher war sie verpflichtet, das Widerspruchsschreiben an das örtlich zuständige Schulamt weiterzuleiten. Eine Schule ist nicht rechtsfähig und kann nicht selbst klagen oder verklagt werden, dementsprechend ist das Schulamt die zuständige Widerspruchsbehörde. Der Kollegin wurde geraten, dem Anwalt eine sogenannte Weiterleitungsmitteilung zu machen, die wie folgt formuliert werden kann: „Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt X, Ihr Widerspruch ist am tt.mm.jjjj bei uns eingegangen. Ich habe den Widerspruch an das hierfür zuständige Schulamt Y weitergeleitet.“
Erst, wenn der Anwalt seinen Widerspruch begründet, wird entschieden. Außerdem kann es sein, dass die zuständige Lehrkraft und die Schulleitung dem Schulamt eine Stellungnahme abgeben müssen. Jedoch ist erst die Widerspruchsbegründung abzuwarten. Ohne eine solche sollte die Kollegin nichts unternehmen und sich zunächst erst wieder melden, wenn diese eingegangen ist.
Gerichtliche Überprüfung
Die gute Nachricht für die Schulen: Erfahrungsgemäß ist das Vorgehen gegen Schulnoten äußerst schwierig. Das hängt mit dem eingeschränkten Prüfungsmaßstab der Gerichte zusammen. Die Gerichte billigen Prüferinnen und Prüfern einen Beurteilungsspielraum zu. Richter besitzen nicht dieselbe pädagogische Fachkenntnis wie Lehrkräfte. Deshalb dürfen sich Richter auf die Einschätzungen von Prüfern berufen und die gerichtliche Überprüfung weitgehend auf formale Aspekte beschränken. Grundsätzlich wird bei der Anfechtung von Noten durch das Gericht lediglich überprüft, ob
• von einem falschen Sachverhalt ausgegangen wurde,
• sachfremde Erwägungen angestellt wurden,
• allgemeingültige Wertmaßstäbe nicht beachtet wurden,
• gegen Verfahrensvorschriften verstoßen wurde oder
• anzuwendende Begriffe oder gesetzliche Rahmen verkannt wurden.
Das Verwaltungsgericht Ansbach führte dies in einem Urteil von 2022 so aus: „In Prüfungsangelegenheiten sind die Kontrollmöglichkeiten der Verwaltungsgerichte eingeschränkt. Aufgabe der Verwaltungsgerichte ist es nicht, ggf. zu strenge oder ungerechte bzw. so empfundene Beurteilungen zu korrigieren, indem das Gericht seine eigenen Bewertungsmaßstäbe an die Stelle der Beurteilungen der Prüfer setzt. Im Wesentlichen betreffen die verwaltungsgerichtlichen Kontrollmöglichkeiten die Einhaltung der Regelungen des einschlägigen Prüfungsverfahrens sowie der Grenzen des prüfungsrechtlichen Beurteilungsspielraums“ (VG Ansbach, Beschluss vom 12.09.2022 – AN 2 E 22.01832).
Abwarten gilt nicht
Im Urteil des VG Ansbach ging es – wie in unserem Fall – um Aspekte des Nachteilsausgleichs. Die Kritik, dass dem Kind zu wenig Arbeitszeit gewährt wurde und Aufgaben nicht vorgelesen wurden, bezog sich ebenfalls nicht auf eine Einzelprüfung, sondern auf Leistungserhebungen über einen längeren Zeitraum und in mehreren Fächern. Dies aber ließ das Gericht so nicht gelten. Verfahrensfehler müssen unverzüglich, das heißt sofort, ohne schuldhaftes Zögern, gerügt werden. Es wäre ja grundsätzlich widersprüchlich: Zunächst Mängel des Prüfungsverfahrens bewusst in Kauf nehmen, um sich die Chance einer vorteilhaften Bewertung etwa aufgrund (vermeintlich) leichter Aufgabenstellung zu erhalten, im Fall des Misserfolgs diese Entscheidung aber revidieren wollen, um nunmehr doch etwaige Verfahrensmängel geltend zu machen.
Im Fall aus Ansbach versuchten die Eltern beziehungsweise der Anwalt noch geltend zu machen, der Junge sei zum früheren Abgeben gedrängt worden. Die Schule habe den Schüler quasi genötigt, den von den Eltern beantragten Nachteilsausgleich (Zeitzugabe) selbst zu widerrufen, was aber nur den Eltern zustände. Das Gericht folgte dieser
Argumentation nicht, sondern verwies darauf, dass es sich bei dem Schüler um einen Sechstklässler am Gymnasium handle, dem man einen entsprechenden Hinweis gegenüber den Lehrkräften zutrauen müsse. Insoweit sei das Abwarten, wie die Probe denn ausfiele, um sich erst danach zu beschweren, nicht in Ordnung gewesen.
Fazit
Wenn Eltern gegen ein Übertrittszeugnis Widerspruch oder Klage erheben, können die betroffenen Schulleitungen und Lehrkräfte ganz ruhig bleiben und auf die Anweisungen des Dienstherrn vertrauen. Im Widerspruchsverfahren werden alle Beteiligten nochmals angehört. Üblicherweise werden die unterrichtenden Lehrkräfte vielleicht noch eine Bemerkung zu den einschlägigen Benotungen ausführen müssen. Als Lehrkräfte haben sie die pädagogische Verantwortung (Art. 52 Abs. 3 BayEUG). Sie können und dürfen kraft ihrer pädagogischen Fachkenntnis Schülerinnen und Schüler so benoten, wie sie es nach ihren didaktischen und fachlichen Einschätzungen für richtig und angemessen halten. Sie müssen also keinesfalls ihre Entscheidungen nochmals überdenken und sind nicht gezwungen, Noten nachträglich abzuändern, nur weil Eltern das so wünschen.