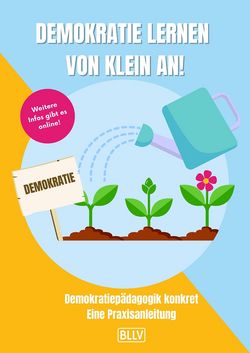Fleischmann: Meine Frage wäre jetzt noch, ob der katholische und der evangelische Religionsunterricht, der Ethikunterricht und der Islamunterricht Silos nebeneinander bleiben sollen oder ob man Veränderungen strukturell herbeiführt? Und das, was Sie jetzt beschreiben, finde ich wunderbar, zu sagen: Meine Berufung. Sozusagen mein Unterrichtsfach. Und das will ich unterrichten.
Doksar: Das muss man auch akzeptieren. Weil am Ende spielt die Lehrerprofessionalität eine Schlüsselrolle und die Lehrkraft muss den Prozess mittragen. Wir können zwar sagen: Das oberste Bildungsziel ist Demokratiebildung. Das stimmt, und das wissen auch alle Lehrkräfte. Aber trotzdem muss die Lehrkraft, die im Unterricht steht, den eigenen Unterricht vertreten können – selbstverständlich im Rahmen ihrer Professionalität. Die Sorgen von Lehrkräften müssen ernst genommen werden. Also wenn eine Lehrkraft Demokratiebildung in ihr Unterrichtsfach integrieren soll, das nicht Politik ist, braucht sie Zeit, um zu überlegen: Möchte ich das? Wie kann ich das umsetzen? Weil gewillt sind sie ja alle. Aber es gibt auch Unsicherheiten. Manche fühlen sich nicht sicher genug, und dem muss Raum gegeben werden. Daher geht meine Forschung in die Richtung, Lehrkräfte zu sensibilisieren, ihnen Ängste zu nehmen und die Scheu abzubauen. Gleichzeitig soll deutlich gemacht werden: Euer Fach wird dadurch nicht entfremdet.
Fleischmann: Das passt auf so vieles, weil wir ja auch über die Schulstruktur nachdenken. Da haben auch viele Angst, dass man ihnen etwas nimmt. Und das wäre vielleicht bei einem katholischen Religionslehrer auch so.
Doksar: Ja, religiöse Bildung darf nicht unterschätzt werden, sie ist bei jungen Menschen präsent. Bei Schülerinnen und Schülern spielt religiöse Bildung nach wie vor eine Rolle. Auch ihre Hintergründe, ihre Herkunft und Wurzeln sind damit verbunden. Der Bedarf an religiöser Bildung ist da. Wenn sie in der Schule keinen Raum findet, dann findet sie aber in den sozialen Medien Raum.
Fleischmann: Und oder womöglich dann ungut, weil sie nicht im Dialog ist. […] Und dann geht es darum, wie lernen wir das den Kleinen. Es geht auch um Religion und die Fragen: Woher kommst du, wer bist du?
Doksar: Selbstverständlich. Es geht um eigene Selbstbestimmung, um die Reflexion der eigenen Religiosität – und im Endeffekt um die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. All das trägt dazu bei, mündige Bürgerinnen und Bürger in einer demokratischen Gesellschaft zu werden. Und wenn wir über die Stärkung von Demokratie sprechen, verfolgen wir einen interdisziplinären Ansatz. Das heißt, verschiedene Bereiche kommen zusammen, und dabei ist es entscheidend, die relevanten Akteure einzubeziehen – sei es aus der Wissenschaft, aus der Bildung oder insbesondere die Lehrkräfte. Und all ihre Perspektiven, ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen müssen berücksichtigt werden. […] Und wenn man mit Lehrkräften, wie ich in meiner Forschung, in den Austausch geht, merkt man: Es gibt viele Chancen und Ressourcen, von denen alle Seiten profitieren können. Insbesondere am Lernort Schule. Wenn wir jetzt Lehrkräfte aus dem Religionsunterricht betrachten, unterrichten diese in der Regel mit den Lehrkräften aus Ethik und Islamischem Unterricht parallel. Jede Schule organisiert das zwar etwas anders, aber oftmals ist es genau so. Und die Lehrkräfte profitieren vom Teamteaching und der gegenseitigen Vernetzung. So kommen wir weg vom Bild der Lehrkraft als Einzelkämpferin und Einzelkämpfer – hin zu einem kollegialen Austausch, der wiederum in diesem Kontext gezielt gefördert wird.
Fleischmann: Absolut. Und das ist dann die Chance und da könnte man auch mal diskutieren: Was braucht es strukturell und was braucht es an Begegnung? Und das, was Sie jetzt sagen, ist Begegnung.