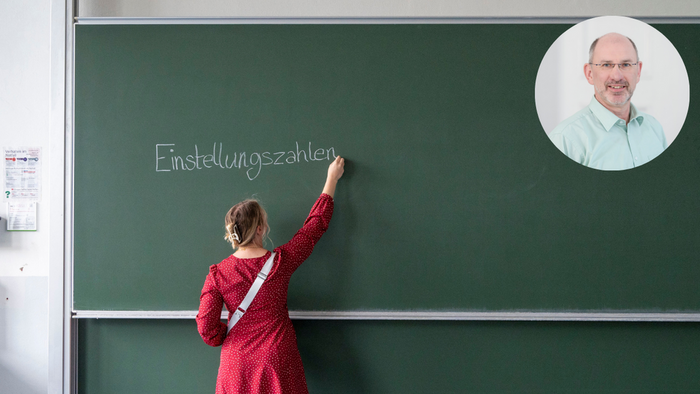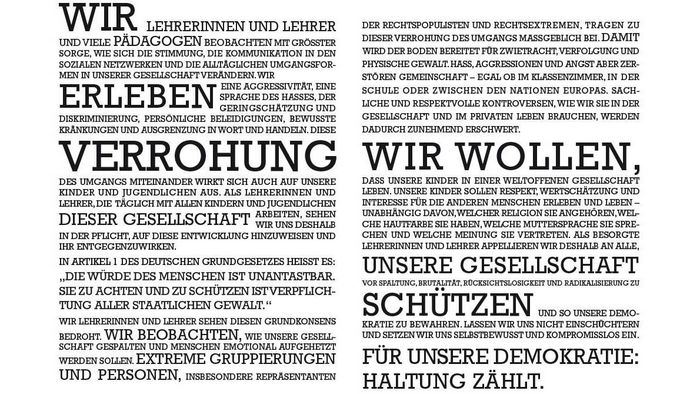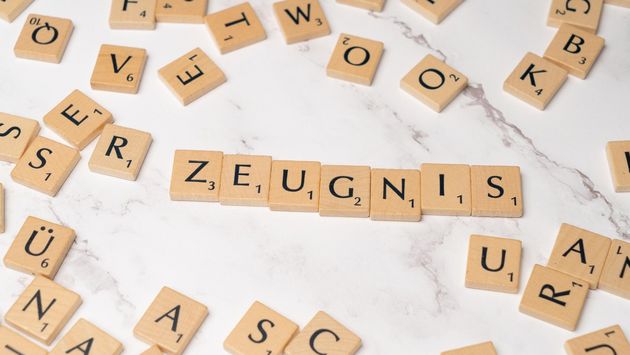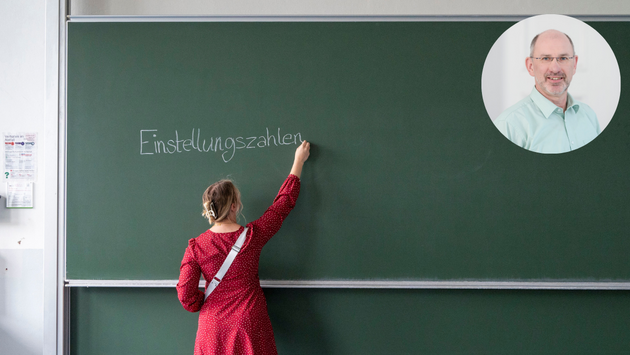Noch sind wir in Bayern in den Ferien und viele wollen noch gar nicht an den Schulstart denken, während andere sich schon intensiv vorbereiten – unter anderem viele Schülerinnen und Schüler, sei es aus Angst vor den neuen Herausforderungen, aus Ehrgeiz oder weil sie von den Eltern dazu angetrieben werden. Die Wahrheit zwischen Erholung und „Dranbleiben“ liegt aber in der Mitte, wie BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann im ausführlichen Interview mit münchen.tv betont: “Ich glaube, die Eltern haben da immer ein gutes Gefühl und das zählt als allererstes. Wann braucht mein Kind mal Ruhe? Wann muss am Ende der Ferien wieder was getan werden? Und oft sind die Kids da die besten Informanten, wenn man mal nachfragt: Was wollen wir noch mal reflektieren? Wie ist denn das im Zeugnis gewesen? Warum hast du da schlecht abgeschnitten? Warum war das so gut? Also das Beste ist, in Dialog mit dem Kind zu gehen.“
Und was ist mit den Lehrerinnen und Lehrern und den oft beneideten sechs Wochen Urlaub? „Das kommt immer ganz darauf an: Bin ich relativ neu im Job und habe das erste Mal eine dritte Klasse, dann muss ich mich anders einarbeiten. Bin ich das erste Mal in einem neuen Fach oder einen neuen Jahrgangsstufe am Gymnasium unterwegs, muss ich mich ganz anders einstellen und den Lehrplan noch anders durcharbeiten. Dann die Frage: Welche Schülerinnen und Schüler übernimmt man, welche Klasse übernimmt man? Wir haben dann auch oft schon Konferenzen und vieles mehr. Also von sechs Wochen Ferien sind wir weit entfernt, aber das macht jeder anders und ich würde mal sagen, 14 Tage oder drei Wochen muss man auch mal raus und den Kopf frei kriegen“, so die BLLV-Präsidentin.
Startet auch dieses Jahr mit Lehrkräftemangel?
Chefredakteurin Marion Gehlert von münchen.tv will im Gespräch auch ganz gezielt wissen, wie es denn jetzt mit dem Lehrkräftemangel aussiet, denn schließlich stünden den 1,7 Millionen Kindern heuer 160.000 Lehrerinnen und Lehrer gegenüber – so viele wie noch nie. Also alles gut? So einfach ist es aber nicht, vor allem wenn man die unterschiedliche Lage an den verschiedenen Schularten betrachtet. Und nicht zuletzt steigen auch die Anforderungen an Schule kontinuierlich, wie die BLLV-Präsidentin betont: „Je mehr Schülerinnen und Schüler wir haben, desto mehr Lehrkräfte brauchen wir. Je mehr Herausforderungen das Leben und die Gesellschaft der Schule stellen, desto mehr Angebote bräuchten wir. Wir haben jetzt seit einigen Jahren Lehrkräftemangel im Grundschulbereich. Im Mittelschulbereich ist leider auch kein Licht am Ende des Tunnels und auch im Bereich der Förderschulen haben wir Lehrkräftemangel. Und auch an den Realschulen, Gymnasien und an den beruflichen Schulen wird der Lehrkräftemangel in den nächsten Jahren zuschlagen. Also es stimmt einfach nicht, dass wir eine gute Ausstattung haben und dass wir nicht wüssten, wohin mit den Köpfen. Ganz im Gegenteil. Und einige Jahre haben wir gerade jetzt im Grundschulbereich echt eine harte Zeit hinter uns.“